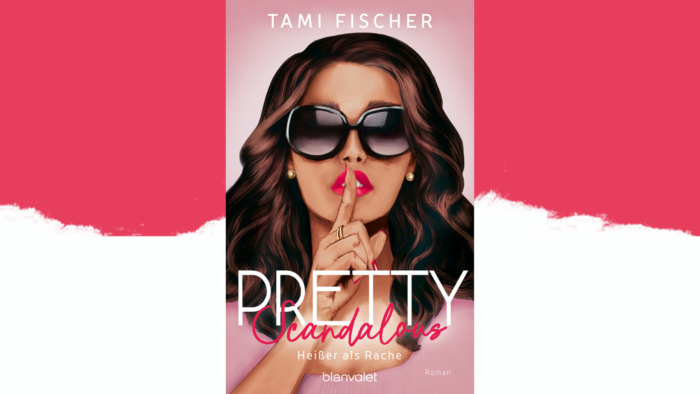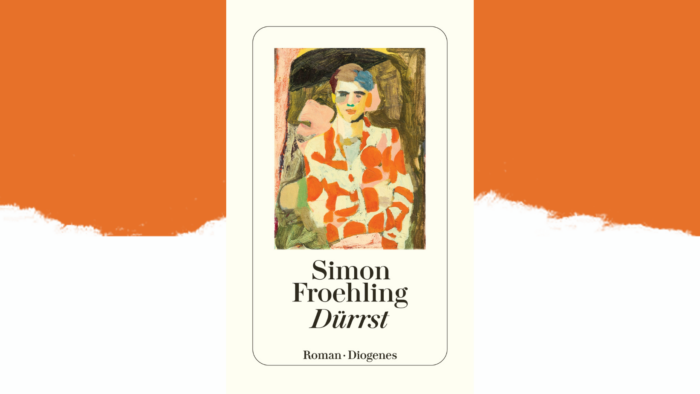Es ist Pfingstmontag. Ein Zoomkästchen schaltet sich in unser Meeting. „Daniela Danz“ steht darin, kurz bevor die Kamera das Gesicht offenbart, das wir in drei Abendvorträgen in den Wochen zuvor am Rednerpult der U2 gesehen haben. Die Thüringer Autorin hebt die Stummschaltung auf; es ertönt die Stimme, mit der sie im Rahmen der 37. Poetikprofessur im Sommersemester 2024 über ihr literarisches Schaffen gesprochen hat. Vor ihrer Abschlussvorlesung hat sich Daniela Danz digital den Fragen des Rezensöhnchens gestellt.

Stellen Sie sich vor, unsere Leser*innen möchten das Oeuvre von Daniela Danz kennenlernen. Welches Werk würden Sie zum Einstieg empfehlen?
Muss es auf eine Seite passen, oder darf es ein ganzes Buch sein? Dann nehmen wir vielleicht den letzten Gedichtband. [Anm. Wildniß, 2020]
Wie begann die Reise des Schreibens für Sie?
So wie für alle, sage ich mal, man fängt als Jugendliche*r an zu schreiben. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gewöhnliche Sache. Und dann ist die entscheidende Frage, ob man damit wieder aufhört. Ich kenne auch viele, die wieder aufgehört haben. Das lag oft daran, dass sie schöne andere Berufe hatten. Und ich nehme mal stark an, dass ich keinen schönen anderen Beruf hatte und deswegen weitergeschrieben habe.
Haben Sie auch in Ihrer Jugend schon Gedichte geschrieben?
Ja, es fing mit Gedichten an oder auch Kurzprosa. Ich glaube auch, das ist allgemein so, dass man in der Jugend in diesen Genres schreibt. Ach so, oder heute Fantasy. Das war zu meiner Zeit noch ein bisschen anders, also in dem Land zumindest, in dem ich groß geworden bin, gab es das noch nicht so. [Anm. DD stammt aus Eisenach, damals der DDR zugehörig].
Wenn wir bei Gattungen sind: Sie sind Essayistin, Lyrikerin und Prosaschriftstellerin, haben eine Graphic Novel und ein Libretto geschrieben. Gibt es eine literarische Gattung, die Ihnen fernliegt?
Fernliegen vielleicht weniger, man kann ja alles probieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ein Libretto schreiben kann, aber dann hatte mich das Thema so interessiert über den NSU [Anm.: Nationalsozialistischer Untergrund], dann habe ich es halt einfach probiert und gelernt [Anm.: Die Oper trägt den Titel „Der Mordfall Halit Yozgat“]. Und ich glaube, man kann einfach ganz viel lernen. Das ist ja auch toll, einfach was Neues auszuprobieren. Ich habe aber tatsächlich noch nie ein Theaterstück geschrieben.
Noch nicht – wäre das auch reizvoll für Sie?
Ja, klar, aber es erfordert einige Mühe. Man ist natürlich am Besten in dem, was man viel rezipiert. Ich gehe zwar schon ins Theater, aber vielleicht einmal im Monat oder so. Ich glaube, um ein guter Theaterautor zu werden, müsste man auch in verschiedenen Städten ins Theater gehen, nicht nur in sein Haus- und Herzenstheater.
Haben Sie eine Quelle, aus der Sie die Inspiration für Ihre Werke schöpfen?
Meine Quelle ist immer noch die Grundfrage, die ich als Jugendliche hatte: In welcher Gesellschaft will ich leben und in welcher Gesellschaft lebe ich? Davon stammen alle Fragen, die mich wirklich richtig beschäftigen. Das ist für mich auch das Persönlichste. Nicht etwa Liebesgedichte, wovon ich kaum welche geschrieben habe, sondern wirklich diese Frage nach der Gesellschaft und wie sie sein sollte; daraus entstehen all die Themen. In meinem ersten Band (= Serimunt, 2004) ging es um Ost- und Westdeutschland, im zweiten Band (= Pontus, 2009) ging es um Europa, wo eigentlich Europas Grenzen sind und was dieses Europa jetzt ist. Im dritten (= V., 2014) darum, was Heimat, Vaterland und Grenzen überhaupt bedeuten und im vierten (= Wildniß, 2020) darum, wie eine Gesellschaft sowohl mit ihrer Natur umgeht – mit dem, was sie da so an natürlichem Umraum hat –, als auch mit sich selbst. Bei Wildniß besteht auch die Frage danach, wie die Gesellschaft mit der Wildnis zwischen den Menschen, mit der Spannung zwischen Zivilisation und Wildnis umgeht. Bei der Prosa hat es mehr mit politischen Dingen zu tun.

Gibt es im Schreiben einen Punkt, ab dem Sie Ihr Werk als gelungen empfinden?
Bei einem schlechten Gedicht kann man sich so ein bisschen in die Tasche lügen und sich sagen „Ist doch toll, ist doch voll das wichtige Thema, das habe ich doch ganz geschickt gemacht hier“… aber eigentlich im Grunde seines Herzens weiß man dann schon, dass es kein gutes Gedicht ist. Man merkt es ganz gut, wenn man es vorliest. Bestenfalls hat man es natürlich vorher schon mitgekriegt. Wenn man dann aber bei einer Lesung denkt „Hui, war das aber anstrengend zu lesen, die armen Leute, die da zuhören müssen“ – da fällt es einem spätestens auf.
Wie wählen Sie Ihre Genres? Ist da zuerst der Stoff und dann die Form oder korrespondiert dies mit verschiedenen Lebensphasen oder Stimmungen?
In der Prosa habe ich ganz andere Themen als in der Lyrik und insofern weiß ich vorher ganz genau: Was mich gerade beschäftigt ist beispielsweise ein Lyrik-Thema. Die Hauptthemen, die über längere Jahre bestehen, sind auch die, die sich in den Gedichtbänden niederschlagen, zum Beispiel das Thema der Wildnis. Das hat verschiedene Aspekte, die mich alle interessieren, also Natur, oder wie gehen wir mit Allmende um oder Verwilderung der Sprache durch Populismus. Da weiß ich am Anfang ziemlich gut, welche Themen für mich dazugehören. Und dann werden manche stärker. Das kommt einfach aus den Erfahrungen, die ich mache, aus gesellschaftlichen Ereignissen. Worum es dann konkret bei einem Thema geht, hängt wirklich davon ab, was mir in den Sinn kommt, tatsächlich wie in diesem Märchen, „woran mein Kopf als erstes stößt“. Also wenn ich dann eine Ameise sehe und mich beschäftigt gerade die Frage nach den Grenzen oder nach der Solidarität und ich sehe, wie diese Ameise sich abmüht, dann merke ich „Ja, eigentlich ist es irgendwie eine Antwort auf diese Frage, die ich gerade habe.“ Deswegen reise ich gerne und lasse zufällige Begegnungen oder Dinge, die mir über den Weg laufen, in mir arbeiten.
Schöpfen Sie eher aus rationalen Überlegungen oder aus Gefühlen?
Die Basis ist immer ein Gefühl. Ich glaube, sonst wird’s schwierig mit der Kunst. Wobei, ‚Gefühl‘ vielleicht weniger, eher wie Rilke sagt, ‚Erfahrung‘. Also eine Grunderfahrung, die ich gemacht habe, die braucht es schon. Es muss etwas sein, das auch andere Menschen berühren kann. Ein Moment, bei dem man sich danach fragt: „Wie fasse ich den? Wie kann ich das festhalten, in Worte fassen?“ Das ist ja nicht einfach. Das kann man dann rational versuchen. Es muss aber stets an eine Erfahrung, an eine persönliche Betroffenheit zurückgebunden sein. Und das muss das Gedicht auch in sich tragen. Es geht schon auch manchmal, dass man sich ein Thema ausdenkt und sagt „Ach, darüber schreibe ich jetzt mal ein Gedicht.“ Dann dichtet man so vor sich hin – man hat ja auch ein bisschen Handwerk gelernt in all den Jahren – und dann ist es fertig und man stellt fest, es steht überhaupt nichts drin, oder schlimmstenfalls ist es noch moralisch. Also das wird nix, wenn man nicht selbst wirklich als Mensch an die Grundfesten seines Menschseins gestoßen ist. Wenn man irgendwie oberschlau meint „Ich zeig euch jetzt mal, wie das geht“, das wird kein gutes Gedicht. Nicht nur bei mir, sondern objektiv.
Sie werden als eine der deutschen Vertreter*innen des Nature Writing betrachtet, haben auch im Januar 2024 die Poetica zu diesem Thema ausgerichtet – was ist Nature Writing für Sie?
Das Schöne an Nature Writing ist, dass es hierzulande ein relativ neues Label ist und damit noch recht geräumig. Ich bin überhaupt immer dafür, dass man Grenzen beweglich hält. Und zu Nature Writing kann alles Mögliche gehören, auch die Natur des Körpers, erweiterte Körperlichkeiten. Für mich ist es eine Fortsetzung von Landschaftsdichtung, sogar aus dem 18. Jahrhundert, die ich mag oder auch Landschaftsdichtung aus der DDR. In der Hinsicht, als diese auch vor allen Dingen schon den menschlichen Eingriff in die Natur thematisiert hat. Aber auch das ist sehr weit gefasst, wo der Mensch da eingreift. Insofern finde ich alles gut. Wenn jetzt eine*r sagt „Hey, ich mach das und das und ich würde das als Nature Writing begreifen“, würde ich sagen „Ah schön, dann lass‘ mal anschauen“. Wenn das Nature Writing in Deutschland eine offene Veranstaltung ist und alle sagen können „Ja du, dieser Beitrag, ich finde, der gehört dazu“, dann sollte der auch mitspielen dürfen.
Dann knüpfen wir mit einem weiteren Wort an. Derzeit findet an der Uni Bamberg der Nachhaltigkeitsmonat statt. Als Wortliebhaberin – was halten Sie von diesem ubiquitär anzutreffenden Begriff der Nachhaltigkeit?
Ja, den liebe ich natürlich deshalb, weil er aus meinem Lieblingsjahrhundert stammt, aus dem 18. Jahrhundert. Und weil ich diese Idee so wichtig finde. Dass sich damals, ein paar Forstmänner – Hans Carl von Carlowitz hat den Begriff ja aufgebracht – es waren in der Zeit ja wirklich nur ein paar wenige Männer, gedacht haben: „Na ja, wenn wir jetzt diesen ganzen Wald abholzen, also wenn wir über das hinausgehen, was wir brauchen, dann regenerieren sich die Ressourcen irgendwann nicht mehr.“ Das viele Holz brauchte man damals, weil die Bevölkerung so exponentiell gewachsen war, damit stieg der Bedarf an lebenswichtigen Produkten und z. B. die Viehweide, aber auch der Luxuskonsum. Man brauchte Holz auch für die Glasverhüttung, für die Möbelindustrie, es gab die erste Katalogware an Hausrat. Dafür haben sie dann den Wald abgeholzt. Und da stießen sie an diese Grenzen, die wir jetzt im großen Stil haben. Also haben sie sich gesagt, wir müssen immer wieder so viel Wald anbauen, wie wir abholzen. Allerdings dauert das mit dem Wald ja immer ein bisschen. Regierende hatten damals ein Interesse, für die nächsten zwei Generationen vorzusorgen, 60 Jahre vorauszuschauen, damit ihre Enkel und Urenkel noch Wald haben; um wirtschaftlich noch stark zu sein, um der Bevölkerung alles zu bieten, was sie braucht. Und das ist ein wenig traurig heutzutage mit den Legislaturperioden, wenn jede Regierung darauf sieht, dass sie wiedergewählt werden muss und Politiker*innen denken „Ich kann nur so radikale Veränderungen, nur so viel Nachhaltigkeit wagen, wie die Leute noch akzeptieren.“ An diesem Begriff hängt für mich auch eine leise Trauer darüber, dass wir so weit politisch nicht mehr agieren können.

Welchen Rat würden Sie angehenden Schriftsteller*innen geben?
Da gibt es zwei Möglichkeiten: Will man schreiben oder will man das auch noch zu seinem Beruf machen, also davon leben? Ein anderer Beruf ist auch eine schöne Sache, kann ich mal als erstes sagen. Man kann ja trotzdem schreiben, ohne es gleich hauptberuflich zu tun. Aber es hängt davon ab, was man schreibt. Prosa verlangt viel Zeit am Schreibtisch. Bei Lyrik schreibt man auch im Kopf, das kann man vielleicht auch, während man andere Dinge macht. Im Kopf sortieren sich viele Dinge schon.
Das Wichtigste ist, viel zu lesen. Das merke ich bei jungen Menschen immer mal wieder, dass sie schreiben, ohne zu lesen. Und ich glaube, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ansonsten bin ich auch ein großer Fan davon, nachzuahmen, weil es etwas Wichtiges ist, zu verstehen, weshalb einen etwas berührt. Sich immer messen an Texten, die man wirklich richtig gut findet. Keine Haltung von „Ach, andere veröffentlichen auch so einen Kram, dann kann ich das auch machen“, sondern nur das, was man richtig gut findet. Sich dann überlegen, wieso ist das gut, woran liegt das? Das ist wirklich schwer herauszufinden, denn ein Text trägt ja einfach ein Rätsel in sich. Aber selbst bei den Texten von Hölderlin versuche ich immer wieder, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Dass man nicht völlig aufgeht in Moden ist, glaube ich, schon auch wichtig. Man kann auch sein ganz eigenes Ding machen. Aber ich glaube, es ist immer gut, wenn man Sachen wagt, die man nicht kann. Also auch mal feste Formen probiert. Auch solche, die einem gar nicht liegen. Zum Eigenen kehrt man am Ende schon wieder von selbst zurück, das setzt sich sowieso durch.
Wichtig ist es auch, wirklich wahrzunehmen, was andere machen, auch in anderen Zeiten und anderen Ländern. Man denkt womöglich, wir wären ach so international, aber tatsächlich ist unsere Lyrik in erster Linie westlich. In anderen Weltgegenden schreibt man anders. Mir hat einmal ein Iraner erklärt: „Die Sachen, wie ihr sie gerade so schreibt, was in Deutschland momentan erfolgreich ist – das würde bei uns alles nicht funktionieren.“ Also gerade so experimentelle Sachen. Dort muss alles bildhaft und möglichst ein wenig ungenau sein. Und ich habe mit ihm als iranischem Muttersprachler versucht, das zu übersetzen oder nachzudichten. Ich hakte immer nach: „Ist die Frau jetzt hinter dem Bus oder vor dem Bus?“, darauf hat er gesagt, „Ist doch egal, sie ist bei dem Bus.“ Durch ihn habe ich gelernt, dass dort gerade diese Unschärfe einfach wichtig ist. Die wir in Deutschland gar nicht mögen, da schreibt man gern mal Rotrückenwürger statt Vogel, auch wenn man den gar nicht kennt. Es funktioniert schlicht anders und das ist meiner Ansicht nach gut zu wissen, dass wir es nicht für der Weisheit letzten Schluss halten, wie es jetzt bei uns läuft.
Sie leiten die internationale Schülertextwerkstatt svolvi, die schon Gedichte aus Armenien, Pakistan und Indien hervorgebracht hat. Wie sind Sie auf diese schöne Idee gekommen?
Als Lyriker*in wird man ganz oft zu internationalen Festivals eingeladen. Da dachte ich: „Na gut, wenn ich jetzt da bin und bin nur auf diesem Festival, dann treffe ich da die internationale Community und lerne doch vom Land gar nichts kennen.“ Es kommt noch hinzu, dass ich sehr gerne Menschen im Alter von 16 bis 18 mag. Deshalb gönne ich es mir dann immer, zu fragen, ob ich dort in der Schule eine Schreibwerkstatt machen kann. Früher waren das Schreibwerkstätten, jetzt arbeite ich auch gern mal mit Filmemacher*innen vor Ort zusammen. In Mumbai zum Beispiel haben wir zusammen Gedichte in Bilder übersetzt, also kleine Poetryfilmchen gedreht. Das war toll, weil man sich darüber gut austauschen kann. Ich habe von Goethe Wanderers Nachtlied genommen, bei dem es eben um die Ruhe im Wald geht. Das war in Mumbai, da gibt es nun, weiß Gott, gar keinen Wald. Aber trotzdem kennt ja jeder Mensch dieses Moment von Stille. Ich habe die Schüler*innen gefragt, wo das für sie ist, und das war interessant: Die sagten dann tatsächlich, wenn sie im Bad sind, weil das der einzige Raum in ihrer Wohnung ist, den sie abschließen können. Und die Vöglein im Walde, die in dem Gedicht vorkommen, da haben sie an ihre Tauben gedacht. Und an Derartiges komme ich, wenn ich in so einem Land mit jungen Menschen einfach direkt über Gedichte sprechen kann.

Interviews, bei denen Sie selbst sich über Ihr Schaffen äußern, sind für Sie an der Tagesordnung. Wenn Sie beim Kolloquium in der nächsten Woche nun etwas über Ihr Werk hören, wenn Sie gewissermaßen interpretiert werden – wie fühlt sich das an?
Na, wie sich das anfühlt, weiß ich noch nicht. Das wird eine vollkommen neue Erfahrung werden. Was Interviews betrifft, das geht ja noch mit dem Beruf Schriftsteller*in. Aber die armen Fußballer*innen, die müssen ja immer dasselbe sagen, wie das Spiel war und so … Da bin ich schon froh, denn ich kann jeden Tag etwas anderes sagen, man entwickelt sich ja ständig weiter. Gestern habe ich Klopstock gelesen, heute bin ich dann auf Klopstock gepolt. Es ändert sich täglich, was man über sich und seine Sachen denkt, letzten Endes sind es alles ohnehin nachträgliche Deutungen.
Vom Rezensöhnchen kommend muss man das beinahe fragen: Lesen Sie gerne Rezensionen, bevor sie zu einem Werk greifen?
Ungern. Auch Anthologien finde ich schwierig oder Zeitschriften, weil es mir so wichtig ist, von einem Autor oder einer Autorin eine Idee zu kriegen. Und die kriege ich wirklich am schnellsten, wenn ich primär lese, worum es geht und wenn ich etliche Texte, auch die nicht so guten, von einer Stimme lese, um zu erfahren, welche Tonlagen sie hat. Natürlich sind Rezensionen wichtig, um eine Auswahl zu treffen oder angeregt zu werden. Das ist womöglich auch mein persönliches Problem, weil ich einfach wenig Zeit habe: Ich habe schon eine ganze Liste von Büchern, die ich sowieso lesen will. Wenn mir jetzt jemand noch mehr empfehlen würde, würde ich es schon gar nicht mehr schaffen. Also deswegen würde ich jetzt nicht nach Rezensionen suchen. Aber übrigens bin ich absolut dankbar, dass es sie gibt; Umso mehr, als die großen Zeitungen und Rundfunkanstalten diese Sparte immer mehr abbauen. Die Rezensionen meiner eigenen Bücher lese ich aber meistens schon, denn oft beziehen sich Moderator*innen in Gesprächen darauf. Aber ich schreibe selbst keine Rezensionen, was ja viele Kolleg*innen tun, das ist die einzige Gattung, auf die ich tatsächlich gar keine Lust habe. Sehr enttäuschend für Ihre Leser*innen wahrscheinlich.
Nein, wir danken für Ihre Ehrlichkeit!
Es ist aber auch schön, dass es das Rezensöhnchen gibt, auch ein toller Name!
Wenn wir bei Namen sind: Ihre Homepage nennt sich Chiragon, altgriechisch für Handführer, ein mechanisches Werkzeug für blinde Schriftsteller. Wie kamen Sie darauf?
Das ist schon ganz lange her, es muss irgendwann vor 2000 gewesen sein. Ich glaube, als Domain war ‚Daniela Danz‘ noch nicht vergeben, aber das schien mir ein bisschen seltsam, meine Homepage so zu nennen. Da war ich auch noch nicht so weit als Autorin. Ich habe ein wenig im Studium geschrieben und dachte „Ach, so eine Homepage ist aber vielleicht eine schöne Sache, oder?“ Ich glaube, ein Freund hat mich überredet. Er hat gesagt, er macht mir jetzt eine Homepage, ich bräuchte so was. Da hätte ich nie meinen Klarnamen genommen, weil ich dachte: „Haha, wen interessiert das schon?“. Und dann habe ich nach einem anderen Namen gesucht. Ich mag das Altgriechische auch gern und ein Blindenlesegerät, das ist nett. Umso mehr, da ich nicht wusste, wie es aussieht. Es schien mir einfach ganz passend. Und vor allen Dingen lenkte es von meinem Namen ab. Das habe ich sehr spät gelernt, dass man die Dinge an seinen Namen knüpfen muss, was Verkauf oder wirtschaftlichen Erfolg betrifft. Ich habe immer alles versteckt, auch meinen Instagramkanal, der hieß immer ‚Kollege Bing‘. Das ist der Name der engsten Mitarbeiterin von Aby Warburg. Die hieß Gertrud Bing, er hat sie immer ‚Kollege Bing‘ genannt. Ich hielt das für einen passablen Namen und habe mir auch nichts dabei gedacht, bis eine meiner Töchter einmal sagte „So geht das nicht“.
Auf ihre Tochter hat Daniela Danz gehört und so findet ihr sie nun auf Instagram unter @danieladanz_.
Ihre Homepage trägt den Namen https://www.chiragon.de/.
Das Interview wurde am 20.05.2024 von Jana Paulina Lobe und Edith Biesold geführt.