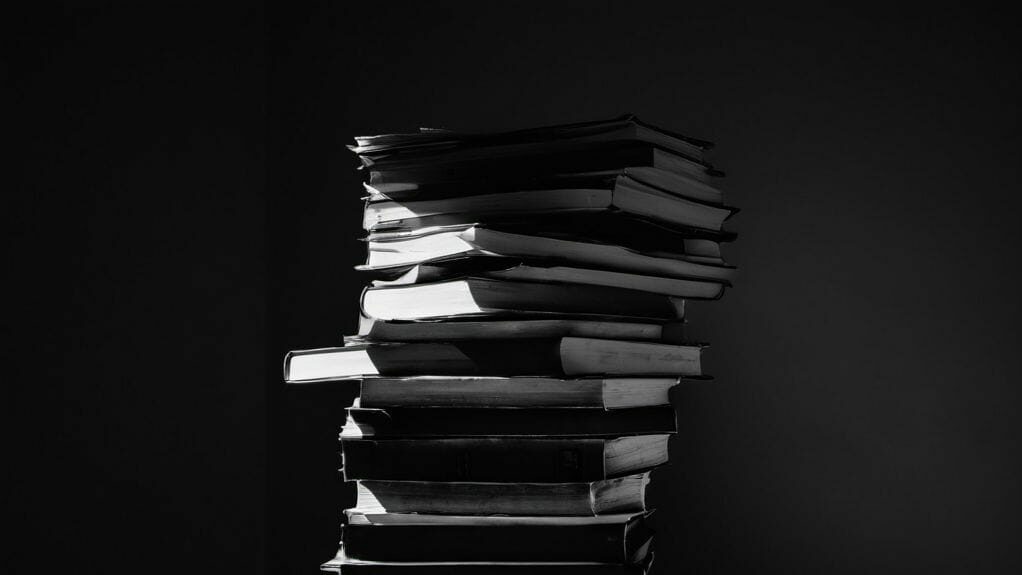Wir sind alle Wiedergänger
—
Generationenkonflikte, Vererbungslehre und biologische Erkenntnisse, Moderne vs. Gestrigkeit und die Urangst des Menschen vor sozialer Ablehnung, die sich in Gesellschaften gebrannt hat – das alles sind Elemente, von denen Henrik Ibsens Drama Gespenster (im Original: Gengangere, norw. für Wiedergänger) lebt. Im Theater Hof feierte das Stück am 22. Dezember 2024 als Inszenierung von Philipp Brammer Premiere. Trotz seines Alters scheint es aktueller denn je.
Gespenster spielt auf einem Anwesen in der zeitgenössischen norwegischen Provinz, Ende des 19. Jahrhunderts. Pastor Manders, wunderbar gespielt von Ralf Hocke, findet sich im Haus von Helene Alving ein, deren Verkörperung durch Anja Stange nicht minder beeindruckend ist. Die beiden wollen sich über die Finanzierung eines Kinderheims beraten, das zu Ehren des verstorbenen Kammerherrn Alving, Helenes Ehemann, errichtet werden soll. Immer wieder kommen weitere Personen dazu, entweder leibhaftig oder im Dialog, deren Biografien untrennbar mit dem Anwesen verknüpft sind. Im Laufe des Stücks werden mehr und mehr Geheimnisse aus der Vergangenheit enthüllt, die deutlich machen, dass der Geist des verstorbenen Herrn Alving nach wie vor über dem Haus liegt und seine Bewohner*innen näher zusammenhält, als ihnen mitunter lieb ist.
„Eigentlich sind wir doch alle Gespenster…“
Vor den Augen des Publikums entfaltet das Stück zwischen minimalistisch gehaltenen Kulissen seine unerbittliche Wirkung. Es konfrontiert Zuschauende mit Themen wie sexuellem Missbrauch, Inzest und Prostitution, Sterbehilfe, den Schichten einer Klassengesellschaft oder der Frage nach Schuld in Bezug auf Geschlechterrollen. Unterstützt wird das Spiel immer wieder durch kleine musikalische Einlagen, wie beispielsweise das Flötenspiel, das den zweiten Akt einläutet. Es klingt simpel und gleichzeitig schräg und mag die innere Zerrissenheit der Figuren widerspiegeln, ganz gleich welcher Form diese ist. Die Requisiten sind auf das Nötigste reduziert, was die Vorstellungskraft der Zuschauenden anregt, die Räumlichkeiten nach eigenen Interpretationen zu vervollständigen. Die Bühne ist in eine vordere und eine hintere Ebene geteilt, sodass die Schauspieler*innen in einigen Szenen nicht ganz von der Bühne abgehen, sondern im Hintergrund wie in Zeitlupe das ausspielen, über was im Vordergrund sonst nur gesprochen werden würde. Über all dem steht die Angst, dass die Gesellschaft von den hauseigenen Skandalen Wind bekommen könnte.
Da gibt es den heruntergekommenen Jakob Engstrand (Oliver Hildebrand), der dem Alkohol zugeneigt ist und der seine Tochter, die junge Haushälterin Regine (Alrun Herbing), lieber bei sich als im Haus der Alvings wüsste – nicht aus väterlichen Gründen, vielmehr aus Eigennutz und dem Wunsch, dass sie ihn finanziell unterstützt. Regine genießt den Zugang zu Bildung, welchen sie bei den Alvings in Anspruch nehmen darf, und möchte nichts von Jakob wissen, nachdem er durch Gewalt und Trunkenheit bereits ihre Mutter Johanne erst in die Prostitution und später ins Grab gebracht hat. Des Weiteren erscheint der Sohn Osvald Alving (Maurice David Ernst), der als Künstler nach zwei Jahren freizügigem Leben in Südeuropa wieder nach Hause gekommen und scheinbar unverändert glücklich ist.
Dazu treffen in Form des Pastors Manders und Helene Alving zwei Ansichten aufeinander, die konträrer nicht sein könnten. Für Manders zählt allein das Wort Gottes, die Rechte und vor allem die Pflichten in einer Familie, die man(n) (aber meistens frau) demütig zu erfüllen habe. Helene, die aus den daraus resultierenden Regeln der Gesellschaft um des guten Rufes willen lange genug das Bild einer intakten Familie und Ehe aufrechterhielt, offenbart nun, inspiriert durch die neu gewonnenen liberalen Ansichten ihres geliebten Sohnes, erstmals die volle Wahrheit. Zwischen den beiden eröffnet sich eine Diskussion über Tradition und Veränderung, und die Fassade des Anwesens Alving beginnt zu bröckeln.
Pastor Manders erscheint als gottesfürchtiger Christ, dem man aber schon zu Beginn ansehen kann, dass er als Mensch ebenso lasterhaft ist wie die weniger gläubigen Figuren des Stücks – ist er doch irritiert und gleichsam fasziniert von Regines Gesäß, das sie bei ihrer Arbeit unabsichtlich in seine Richtung reckt. Helene Alving präsentiert sich fast das gesamte Stück hindurch als ernste und vernünftige Frau, die hinter den Meinungen steht, die sie vertritt. Nur manchmal durchbrechen ihre Emotionen die Fassade der Standhaftigkeit und lassen die Zuschauenden erahnen, wie viel Aufruhr bereits in ihrem Innerem geherrscht hat.
Mit eindrucksvollen und ernsten Stimmen und der ein oder anderen komischen Situation führen die Schauspieler*innen durch das Stück, dessen Entfaltung die Zuschauenden in seinen Bann zieht. Das ruchlose Leben von Herrn Alving, das der Öffentlichkeit nie offenbart wurde, hat einem Wurzelwerk gleich in die Leben anderer ausgetrieben und sich dort festgesetzt, sodass seine Spuren auch zehn Jahre nach seinem Tod in den Biografien seines Umfelds zu finden sind. Im Laufe des Stücks öffnet sich Helene gegenüber Manders, und berichtet ihm von seit Jahren gehüteten Geheimnissen in Form von Affären, Kuckuckskindern, sozialem Abstieg und Weiterem, was nicht nur den Pastor die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lässt.
Als ungünstige Kreuzungen einiger Spuren aus der Vergangenheit bekannt werden, kommen schließlich die titelverweisenden „Gespenster“ ins Spiel: „Ich bin ängstlich und verstört, weil es mir nicht gelingt, mich von diesem Spuk zu befreien!“ Der Spuk, der über dem Haus hängt, aber auch in der Gesellschaft feststeckt, aus deren christlichen Prägungen man (und vor allem frau) sich nicht wirklich befreien kann, die an einem kleben wie Spinnweben.
Das Stück Gespenster schockt damals wie heute mit der Brutalität der Umstände, die es anspricht, und beeindruckt mit der sprachlichen Feinheit, die in wenigen Worten viel Information offenbart. An seiner Aktualität hat sich wenig geändert, weshalb es auch heute noch zum Nachdenken über Geschlechterrollen und gesellschaftliche Strukturen anregt. Die wunderbare Darbietung durch alle fünf Schauspielenden rundet diese ergreifende Inszenierung ab und macht sie zur Empfehlung für Theaterliebhabende, die Ibsens Ernsthaftigkeit schätzen.
Die nächsten Aufführungen finden am 11.01., 24.01., 08.02., 22.02., 07.03., 14.03., 29.03. und 13.04.2025 statt.
von Nike Kutzner



Bilder links: Oliver Hildebrandt (Tischler Engstrand), Alrun Herbing (Regine Engstrand); Bild mittig: Alrun Herbing (Regine Engstrand), Anja Stange (Helene Alving), Ralf Hocke (Pastor Manders); Bild rechts: Alrun Herbing (Regine Engstrand), Anja Stange (Helene Alving), Maurice Daniel Ernst (Osvald Alving)


Bild links: vorn v.l. Ralf Hocke (Pastor Manders), Anja Stange (Helene Alving); im Hintergrund Alrun Herbing (Regine Engstrand), Maurice Daniel Ernst (Osvald Alving); Bild rechts: Alrun Herbing (Regine Engstrand), Maurice Daniel Ernst (Osvald Alving), Anja Stange (Helene Alving)